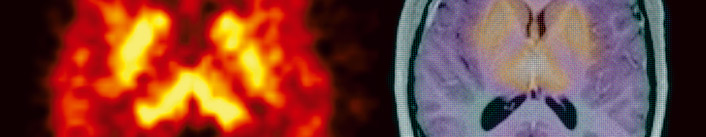Leitlinien
Leitlinie für die Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulographie
E. Kleinhans, Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum der RWTH, Aachen
Leitlinie in Anlehnung an Wittry MD, Juni EJ, Royal HD, Heller GV, Port SC. Procedure Guideline for Equilibrium Radionuclide Ventriculography. J Nucl Med 1997; 38: 1658–61.
E. Kleinhans, Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum der RWTH, Aachen
Leitlinie in Anlehnung an Wittry MD, Juni EJ, Royal HD, Heller GV, Port SC. Procedure Guideline for Equilibrium Radionuclide Ventriculography. J Nucl Med 1997; 38: 1658–61.
| zurück zur Übersicht |
- Zielsetzung
Ziel dieser Leitlinien ist die Unterstützung nuklearmedizinisch tätiger Ärzte bei der Indikationsstellung, Durchführung, Interpretation und Befundung der gegateten Radionuklid-Ventrikulographie.
- Hintergrundinformation und Definitionen
Bei der gegateten Äquilibrium-Radionuklid-Ventrikulographie (RNV) werden patienteneigene Erythrozyten radioaktiv markiert und EKG-synchronisiert szintigraphische Aufnahmen erstellt. Es werden eine oder mehrere Messungen der links-und/ oder rechtsventrikulären Funktion durchgeführt. Alternative Bezeichnungen für diese Technik sind: gegatete Herzbinnenraum-Szintigraphie, multigated Akquisition (MUGA) und gegatete Äquilibrium-Radionuklid-Angiographie (RNA).
Über mehrere hundert Herzzyklen werden Zählraten herzphasengerecht in einer Bildsequenz gesammelt und als schlagendes Herz in einem einzigen repräsentativen Zyklus dargestellt.
Die Methode liefert Aussagen über
- die regionale und globale Wandbewegung
- die Größe und Morphologie der Herzkammern
- die ventrikuläre systolische und diastolische Funktion einschließlich links- und rechtsventrikulärer Ejektionsfraktion
- die regionale und globale Wandbewegung
- Wesentliche Indikationen
- Die RNV liefert Aussagen über folgende Parameter
- globale systolische Ventrikelfunktion
- regionale Wandbewegung
- Ventrikelvolumina (qualitativ und quantitativ)
- Änderungen dieser Parameter unter Belastung oder anderen Interventionen
- systolische und diastolische Indizes
- Schlagvolumina
- Folgende klinische Fragestellungen sind sinnvolle Indikationen zur RNV
- bei Verdacht auf oder bei bekannter koronarer Herzkrankheit (KHK)
- KHK ohne vorausgegangenen Myokardinfarkt (MI)
- länger zurückliegender MI
- akuter MI
- bei Verdacht auf oder bei gesicherten angeborenen Herzfehlern
- zur Unterscheidung ischämischer und nicht-ischämischer Ursachen
- zur Unterscheidung systolischer und diastolischer Ursachen
- Bestimmung der Pumpfunktion bei Patienten unter Chemotherapie
- Bestimmung der Ventrikelfunktion bei Klappen-Vitien (Stenosen und/oder Insuffizienzen)
- Bewertung der Ventrikelfunktion vor geplanter Herztransplantation
Bei den o.g. Fragestellungen ist die RNV hilfreich zur Abschätzung der (a) Langzeit- und der (b) Kurzzeitprognose (z.B. präoperativ) sowie (c) des Ansprechens auf chirurgische oder andere therapeutische Interventionen.
- Die RNV liefert Aussagen über folgende Parameter
- Durchführung der Untersuchung
- Patientenvorbereitung
- Ruhe: Keine spezielle Vorbereitung erforderlich. Medikamente brauchen nicht abgesetzt werden. Die Elektroden zur Triggerung müssen gut leitend und sicher auf der Haut fixiert sein, um ein optimales EKG-Signal zu erhalten.
- Belastung: Der Patient sollte wenigstens drei bis vier Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben. Er sollte sowohl hämodynamisch als auch klinisch stabil sein. Die (Fahrrad-) ergometrische Belastung ist generell zu bevorzugen. Patienten, bei denen aus nichtkardialen Gründen eine ergometrische Belastung nicht möglich ist, können pharmakologisch belastet werden. Medikamente, die das Ansprechen der Herzfrequenz auf Belastung beeinflussen, sollten abgesetzt werden, außer bei medizinischer Kontraindikation oder wenn die Medikamentenwirkung unter Belastung untersucht werden soll.
- Ruhe: Keine spezielle Vorbereitung erforderlich. Medikamente brauchen nicht abgesetzt werden. Die Elektroden zur Triggerung müssen gut leitend und sicher auf der Haut fixiert sein, um ein optimales EKG-Signal zu erhalten.
- Notwendige Vorabinformation
Eine angemessenere Anamnese und die Erhebung eines orientierenden kardiovaskulären Status sollte der diagnostischen Intervention vorausgehen. Insbesondere sollten Indikation(en) für die Untersuchung, Medikation, Symptomatik, kardiale Risikofaktoren und frühere diagnostische oder therapeutische Maßnahmen geklärt werden. Der Herzrhythmus des Patienten muß überwacht werden, weil ausgeprägtere Arrhythmien sowohl die Durchführung als auch die Interpretation der RNV beeinträchtigen können. Physikalische Limitationen können die Durchführung einer physikalischen Belastung erheblich erschweren oder unmöglich machen. Ein Ruhe-EKG mit zwölf Ableitungen sollte vor jeder Belastung registriert werden.
- Vorsichtsmaßnahmen/Kontraindikationen
- Bei In-vitro-Markierung autologer roter Blutkörperchen muß durch eine geeignete Prozedur gewährleistet sein, daß eine versehentliche Reinjektion am falschen Patienten ausgeschlossen ist.
- Bei Patienten mit potentiell instabilem Herzrhythmus (z.B. paroxysmale supraventrikuläre oder ventrikuläre Tachykardie) oder mit implantiertem Schrittmacher (z.B. Defibrillator) können besondere Vorkehrungen wegen unvorhersehbarer belastungsinduzierter Rhythmusstörungen erforderlich sein.
- Bei In-vitro-Markierung autologer roter Blutkörperchen muß durch eine geeignete Prozedur gewährleistet sein, daß eine versehentliche Reinjektion am falschen Patienten ausgeschlossen ist.
- Radiopharmaka
Beim Erwachsenen werden üblicherweise zwischen 600 und 1100 MBq Tc-99m zur Markierung autologer roter Blutzellen mittels In-vivo-, modifizierter In-vitro- oder In-vitro-Technik appliziert (Tab. 1). Bei Kindern ist die Dosierung 7–15 MBq/kg, mindestens aber 70-150 MBq (Tab. 2). Das kritische Organ mit der höchsten absorbierten Strahlendosis ist das Herz mit etwa 0,02 mSv/MBq. Tc-99m-markierte Erythrozyten verteilen sich im Intravasalraum, dessen Volumen sich zu 4–7% des Körpergewichts schätzten läßt. Die geschätzte biologische Halbwertzeit liegt bei 24 bis 30 Stunden. Ungefähr ein Viertel der applizierten Aktivität wird in den ersten 24 Stunden renal eliminiert. Die Markierung ist am wenigsten stabil bei der In-vivo-Methode und am haltbarsten bei der In-vitro-Methode. Eine alternative Methode ist die Verwendung von Tc-99m-markiertem humanem Serum-albumin (HSA).
Radiopharmakon Applizierte Aktivität
(MBq)Kritisches Organ
(mGy/MBq)Effektive Dosis
(mSv/MBq)Tc-99m-markierte Erythrozyten1 555–1110 i.v. 0,023 Herz 0,0085 Tc-99m-Albumin2 370–740 i.v. 0,020 Herz 0,0079 Tab. 1: Dosimetrie bei Erwachsenen
1ICRP 53, S. 210; 2ICRP 532, S. 173
Radiopharmakon Applizierte Aktivität
(MBq)Kritisches Organ
(mGy/MBq)Effektive Dosis
(mSv/MBq)Tc-99m-markierte Erythrozyten1 7–15 i.v. 0,062 Herz 0,025 Tc-99m-Albumin2 370–740 i.v. 0,054 Herz 0,023 Tab. 2: Dosimetrie bei Kindern (5 Jahre) 1ICRP 53, S. 210; 2ICRP 532, S. 173 - Datenakquisition
- Ruhe
- Ausrüstung und Geräte: Die Akquisition erfolgt mit einer Gammakamera und angeschlossenem Computersystem. Verwendet wird ein niederenergetischer Allzweck-Kollimator (LEAP) oder ein hochauflösender Parallelloch-Kollimator. Ein zur Triggerung geeigneter EKG-Monitor sollte an den Computer angeschlossen sein. Vor der Untersuchung muß die Simultaneität des EKG-Trigger-Impulses mit dem QRS-Komplex überprüft werden. Das Fenster für die RR-Intervall-Toleranz sollte so groß gewählt werden, daß einerseits der Variabilität des RR-Intervalls, andererseits eventuellen Ektopien Rechnung getragen wird. Die softwaremäßige Arrhythmie-Erkennung mit unmittelbarer Unterdrückung der heterochronen Herzaktionen bei der Akquisition ist heute state of the art. Bei heterogener Verteilung der RR-Intervalle (z.B. beim Bigeminus) empfiehlt sich die Akquisition im sog. »List-Mode«, der die nachträgliche Erzeugung eines repräsentativen Herzzyklus selektiv für einen bestimmten Herzfrequenz-Bereich erlaubt.
- Akquisitionsparameter: Mindestens 16 Bilder pro RR-Intervall sind zur akkuraten Bewertung der Wandbewegung und zur Bestimmung der Ejektionsfraktion erforderlich. Zur genauen Messung diastolischer Füllungsparameter werden höhere Bildraten (32 bis 64 Bilder pro RR-Intervall) benötigt. Der Kamera- bzw. Computer-Zoom-Faktor sollte so gewählt werden, daß das Herz etwa die Hälfte des Gesichtsfelds einnimmt. Typischerweise werden drei bis sieben Millionen Counts akquiriert. Die Akquisition erfolgt in Rückenlage in links anterior schräger Projektion (LAO), wobei der Winkel von ca. 45% so lange variiert werden sollte, bis die beste Trennung von rechtem und linkem Ventrikel bzw. die optimale Septumdarstellung erreicht ist. Zusätzliche Projektionen aus anteriorer (0°), links seitlicher (90°), 70°-LAO- oder 30°-RAO-Sicht sind zur visuellen Beurteilung der Bewegung aller Wandabschnitte hilfreich. Ein Slanthole-Kollimator kann zur Kippung der transversalen Akquisitionsebene nach kaudal verwendet werden, um eine bestmögliche Trennung der Ventrikel von den Vorhöfen zu erreichen. Derselbe Effekt läßt sich durch die Einstellung eines kaudalen Tilt-Winkels (5° bis 15°) erzielen.
- Ausrüstung und Geräte: Die Akquisition erfolgt mit einer Gammakamera und angeschlossenem Computersystem. Verwendet wird ein niederenergetischer Allzweck-Kollimator (LEAP) oder ein hochauflösender Parallelloch-Kollimator. Ein zur Triggerung geeigneter EKG-Monitor sollte an den Computer angeschlossen sein. Vor der Untersuchung muß die Simultaneität des EKG-Trigger-Impulses mit dem QRS-Komplex überprüft werden. Das Fenster für die RR-Intervall-Toleranz sollte so groß gewählt werden, daß einerseits der Variabilität des RR-Intervalls, andererseits eventuellen Ektopien Rechnung getragen wird. Die softwaremäßige Arrhythmie-Erkennung mit unmittelbarer Unterdrückung der heterochronen Herzaktionen bei der Akquisition ist heute state of the art. Bei heterogener Verteilung der RR-Intervalle (z.B. beim Bigeminus) empfiehlt sich die Akquisition im sog. »List-Mode«, der die nachträgliche Erzeugung eines repräsentativen Herzzyklus selektiv für einen bestimmten Herzfrequenz-Bereich erlaubt.
- Belastung
- Ausrüstung und Geräte: wie E1.a, jedoch sollte bei Belastungsuntersuchungen ein hochempfindlicher Kollimator bevorzugt werden.
- Akquisitionsparameter: wie E1.b. Zur Beurteilung der Wandbewegung und zur Bestimmung der Ejektionsfraktion (LVEF) reichen 16 Bilder pro RR-Intervall aus. Auf dem Fahrrad-Ergometer wird in liegender, halbaufrechter oder aufrechter Position akquiriert, in optimierter LAO-Projektion (siehe E1.b) oder anderen, zur Beurteilung bestimmter Wandabschnitte geeigneter Projektionen. Die Ejektionsfraktion läßt sich am zuverlässigsten nur in optimierter LAO-Projektion bestimmen.
Aufnahmen können bei jeder Belastungsstufe mit einer Akquisitionsdauer von zwei bis drei Minuten akquiriert werden. Es ist vorteilhaft, die Akquisition erst ca. eine Minute nach Beginn jeder neuen Belastungsstufe zu starten, weil sich die Herzfrequenz dann erfahrungsgemäß stabilisiert hat. Eine Akquisition direkt nach Abbruch der Belastung ergibt Aufschluß über kardiale Funktion in der Erholungsphase.
Pharmakologische Belastungstests mit positiv-inotropen Substanzen oder Vasodilatatoren sowie atriales oder ventrikuläres Pacing sind weniger gebräuchliche Alternativen zum physikalischen Belastungstest.
- Ausrüstung und Geräte: wie E1.a, jedoch sollte bei Belastungsuntersuchungen ein hochempfindlicher Kollimator bevorzugt werden.
- Ruhe
- Interventionen
keine
- Datenauswertung
Die Bildsequenz sollte zunächst als »Cine Loop« dargestellt werden, um die Zählraten-Statistik, die korrekte EKG-Triggerung, die Güte der radiopharmazeutischen Bindung und die Patienten-Positionierung zu überprüfen. Vor der EF-Berechnung sollte die linksventrikuläre systolische Funktion subjektiv bewertet werden. »Regions of interest« (ROIs) werden von Hand oder automatisch mithilfe eines geeigneten Computer-Programms so um den linken Ventrikel gelegt, daß die gesamte linksventrikuläre Aktivität von der ROI erfaßt wird. Die zur Untergrund-Korrektur verwendete ROI darf keine Aktivität aus der Milz oder der Aorta descendens beinhalten. Weitere systolische oder diastolische Funktionsparameter können berechnet werden. Bei Diskrepanzen zwischen der berechneten LVEF und der qualitativen (subjektiven) linksventrikulären systolischen Funktion sollte eine Zweitauswertung erfolgen. Ventrikel-Volumina können durch Zählratenbasierte oder geometrische Verfahren bestimmt werden. Bei Patienten mit Verdacht auf Klappen-Vitien ist die Berechnung des Schlagvolumens hilfreich. Parametrische Bilder (Amplituden- und Phasenbilder) können erzeugt werden.
- Befundung und Dokumentation
- Bildqualität: Der Arzt sollte zunächst die generelle Qualität der Bilddaten bewerten, besonders im Hinblick auf die Güte der Erythrozyten-Markierung (Verhältnis Herz/Untergrundaktivität), die EKG-Triggerung und die korrekte Projektion.
- Herzmorphologie: Morphologie, Lage und Größe der Herzkammern und der großen Gefäße sollten subjektiv bewertet und mitgeteilt werden. Ebenso kann die Dicke der Herzsilhouette und der Ventrikelwand bewertet und dokumentiert werden. Die gemessenen absoluten Ventrikel-Volumina sollten ebenfalls mitgeteilt werden.
- Systolische Ventrikel-Funktion: Die visuell geschätzte globale linksventrikuläre Funktion sollte mit der berechneten Ejektionsfraktion verglichen werden. Gegebenenfalls ist bei Diskrepanzen eine erneute Auswertung erforderlich. Die regionale Wandbewegung aller linksventrikulärer Wandsegmente sollte durch Betrachten der Cine-Sequenz beurteilt und Wandbewegungsstörungen mit den gängigen Termini Hypokinesie, Akinesie und Dyskinesie beschrieben werden. Für systematische Befundberichte empfiehlt sich die Verwendung standardisierter Vorlagen. Bei der Beurteilung des zeitlichen Verlaufs und des Ausmaßes der Ventrikelkontraktion sind parametrische Bilder wie Phasen- und Amplitudenbilder hilfreich, insbesondere zur Identifizierung der Klappenebenen und von Reizleitungsstörungen. Die Funktion des rechten Ventrikels läßt sich durch die Berechnung der rechtsventrikulären Ejektionsfraktion näherungsweise bestimmen. Zur genaueren Bestimmung ist jedoch eine andere Technik erforderlich, zum Beispiel die »First Pass Radionuklid-Angiographie«.
- Rhythmus: Bei der Befundung sollte ein Einkanal-Rhythmus-Streifen vorliegen.
- Belastungstests: Die Belastungsstudie sollte zusammen mit der Ruheuntersuchung im Cine-Mode dargestellt werden. Änderungen der Kammergrößen, der regionalen Wandbewegung sowie der globalen Ejektionsfraktion beider Ventrikel sollten visuell bewertet und dokumentiert werden.
- Vergleich mit Voruntersuchungen: Die Ergebnisse sollten im direkten kinematographischen Vergleich mit allen Voruntersuchungen – soweit möglich – evaluiert werden. Falls erforderlich sollten Diskrepanzen durch wiederholte Auswertungen geklärt und beseitigt werden.
- Bildqualität: Der Arzt sollte zunächst die generelle Qualität der Bilddaten bewerten, besonders im Hinblick auf die Güte der Erythrozyten-Markierung (Verhältnis Herz/Untergrundaktivität), die EKG-Triggerung und die korrekte Projektion.
- Qualitätssicherung
siehe H1
- Fehlerquellen
- Erythrozyten-Markierung: Bestimmte Medikamente (z.B. Heparin) und Krankheitsprozesse (z. B. chronisches Nierenversagen) beeinflussen die Markierungsausbeute und damit das Herz/Untergrund-Verhältnis.
- Patienten-Positionierung: Fehler bei der Bestimmung der Auswurffraktion können aus der Überlagerung des linken Ventrikels mit anderen kardialen Strukturen resultieren.
- Trigger-Fehler: Ein schwaches EKG-Signal oder ein Signal, dessen QRS-Komplex durch Störungen unterdrückt wird, kann zu devianten Trigger-Impulsen und damit zu nicht auswertbaren Daten führen. Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, daß der QRS-Komplex mit dem tatsächlichen Trigger-Impuls identisch ist.
- Schwankungen der Herzfrequenz
- Ausgeprägte Schwankungen der Herzfrequenz können die Zuverlässigkeit diastolischer Füllungsparameter empfindlich beeinträchtigen.
- Schwankungen der Herzfrequenz
- Zählraten-Statistik: Unzureichende Zählraten reduzieren sowohl die Interpretierbarkeit der Bilddaten als auch die statistische Zuverlässigkeit quantitativer Messungen.
- Fehler bei der Auswertung: Der Einschluß nichtventrikulärer Aktivität oder der Ausschluß ventrikulärer Aktivität bei der Definition der Ventrikel-ROI kann zu einer nicht unerheblichen Unter- oder Überschätzung der Ejektionsfraktion führen. Der Einschluß von Strukturen wie der Milz oder der Aorta descendens in die Untergrund-ROI können die Ejektionsfraktion gleichermaßen verfälschen.
- Erythrozyten-Markierung: Bestimmte Medikamente (z.B. Heparin) und Krankheitsprozesse (z. B. chronisches Nierenversagen) beeinflussen die Markierungsausbeute und damit das Herz/Untergrund-Verhältnis.
- Patientenvorbereitung
- offene Fragen
keine
Literatur
- Alexander J, Daniak N, Berger HJ, et al. Serial assessment of doxorubicin cardiotoxicity with quantitative radionuclide angiocardiography. N EngI J Med 1979; 300: 278-83.
- Bacharach SL, Bonow RO, Green MV. Comparison of fixed and variable temporal resolution methods for creating gated cardiac blood-pool image sequences. J Nucl Med 1990; 31: 38-42.
- Bacharach SL, Green MV, Borer JS, et al. Left ventricular peak ejection rate, peak filling rate and ejection fraction: frame rate requirements at rest and exercise. J Nucl Med 1979; 20: 189-93.
- Bonow RO. Radionuclide angiography for risk stratification of patients with coronary artery disease (Editorial). Am J Cardiol 1993; 72: 735-9.
- Bonow RO, Kent KM, Rosing DR, et al. Exerciseinduced ischemia in mildly symptomatic patients with coronary artery disease and preserved left ventricular function: identification of subgroups at risk of death during medical therapy. N Engl J Med 1984; 311: 1339-45.
- Bonow RO. Picone AL, Melntosh CL, et al. Survival and functional results after valve replacernent for aortic regurgitation frorn 1976 to 1983: impact of preoperative left ventricular function. Circulation 1985; 72: 1244-56.
- Bonow RO, Rosing DR. Kent KM, et al. Timing of operation for chronic aortic regurgitation. Am J Cardiol 1982; 50: 325-36.
- Breisblatt WM, Vita NA, Armuchestegui M, et al. Usefulness of serial radionuclide rnonitoring during graded nitroglycerin infusion for unstable angina pectoris for determining left ventricular function and individual therapeutic dose. Am J CardioI 1988; 61: 685-90.
- Dilsizian V. Rocco TP, Bonow RO. et al. Cardiac bloodpool imaging II: applications in noncoronary heart disease. J Nucl Med 1990; 31: 10-22.
- Juni JE. Chen CC. Effects of gating modes on the analysis of left ventricular function in the presence of heart rate variation. J Nucl Med 1988; 29: 1272-8.
- Knesewitsch P, Kleinhans E, Seiderer M, Klepzig M, Büll U. Die quantitative Ruhe-Radionuklid-Ventrikulographie zur multifaktoriellen Analyse der linksventrikulären Funktion. Germ J Nucl Med 1984; 23: 163-9.
- Knesewitsch P, Fritsch S, Kleinhans E. Combined evaluation of first pass radionuclide angiography and equilibrium radionuclide ventriculography in the diagnosis of coronary artery disease. II. Results during exercise. Eur J Nucl Med 1987; 12: 598-601.
- Lee KL, Pryor DP, Peiper KS, et al. Prognostic value of radionuclide angiography in medically treated patients with coronary artery disease: a comparison with clinical and catheterization variables. Circulation 1990; 82: 1705-17.
Links JM. Becker LC, Shindledecker JG, et al. Measurement of absolute left ventricular volume from gated bloodpool studies. Circulation 1982; 65: 82-91.
- Mahmarian JJ, Moye L, Verani MS. et al. Criteria for the accurate interpretation of changes in the left ventricular ejection fraction and cardiac volumes as assessed by rest and exercise gated radio-nudide angiography. J Am CoII Cardiol 1991; 18: 112-9.
- Massardo T, Gal RA, Grenier RP, et al. Left ventricular volume calculation using a countbased ratio method applied to multigated radionuclide angiography. J Nucl Med 1990; 31: 450-6.
- Miller TR, Goldman KJ, Sampathkumaran KS, et al. Analysis of cardiac diastolic dysfunction: application in coronary artery disease. J Nucl Med 1983; 24: 2-7.
- Palmeri ST, Bonow RO, Meyers CE, et al. Prospective evaluation of doxorubicin cardiotoxicity by rest and exercise radionuclide angiography. Am J CardiolI 1986; 58: 607-13.
- Polak JR, Kemper A, Bianco JA, et al. Resting early peak diastole filling rate: a sensitive index of myocardial dysfunction in patients with coronary artery disease. J Nucl Med 1982; 23: 471-8.
- Rocco TP, Dilsizian V, Fischman AJ, et al. Evaluation of ventricular function in patients with coronary artery disease. J Nucl Med 1989; 30: 1149-65.
- Seiderer M, Kleinhans E, Büll U, Strauer BE. Die regionalen Auswurffraktionen zur Beurteilung der linksventrikulären Funktion. Ein Vergleich von Äquilibrium -Radionuklid-Ventrikulographie mit den Ergebnissen der Kineventrikulographie. Fortschr Rö 1982; 4: 363-494.
- Seiderer M, Bohn I, Büll U, Kleinhans E, Strauer BE. Influence of background and absorption correction on nuclear quantification of left ventricular enddiastolic volume. Brit J Rad 1983; 56: 183-7.
- Spirito P, Maron BJ, Bonow RO. Noninvasive assessment of left ventricular diastolic function: comparative analysis of Doppler echocardiographic and radionuclide techniques. J Am CoII Cardiol 1986; 7: 518-26.
- Stewart RAH, McKenna WJ. Assessrnent of diastolic filling indexes obtained by radionuclide ventriculography. Am J Cardiol 1990; 65: 226-30.
- Upton MT, Rerych SK, Newman GE, et al. The reproducibility of radionuclide angiographie measurements of left ventricular function in normal subjects at rest and during exercise. Circulation 1980; 62: 126-32.
- U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service. Clinical Practice Guideline Number 11. Heart failure: evaluation and care of patients with leftventricular systolic dysfunction. AHCPR Publication No. 94-0612, 1994.
| zurück zur Übersicht |