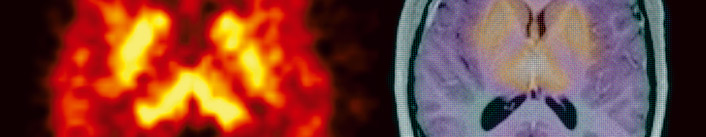Leitlinien
FDG-PET/CT in der Onkologie*
B. J. Krause1, T. Beyer2, A. Bockisch2, D. Delbeke3, J. Kotzerke4, V. Minkov5, M. Reiser6, N. Willich7, Arbeitsausschuss Positronenemissionstomographie der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin**
1Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Universität München, 2Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen, 3Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, USA, 4Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Dresden, 5Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, 6Institut für Klinische Radiologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, 7Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie – Radioonkologie, Universitätsklinikum Münster, Germany
* Sections of this document were translated and reprinted with permission of the Society of Nuclear Medicine, Procedure Guidelines for Tumor Imaging with 18F-FDG PET/CT: Delbeke D (Chair), Coleman RE, Guiberteau MJ, Brown ML, Royal HD, Siegel BA, Townsend DW, Berland LL, Parker JA, Hubner K, Stabin MJ, Zubal G, Kachelreiss M, Cronin V, Hoolbrook S. Society of Nuclear Medicine Procedure Guidelines for Tumour Imaging using FDG PET/CT. J Nucl Med 2006; 47: 885–895.
** Mitglieder des Arbeitsausschusses PET der DGN (in alphabetischer Reihenfolge): P. Bartenstein (München), R. P. Baum (Bad Berka), W. Burchert (Bad Oeynhausen), U. Haberkorn (Heidelberg), R. Kluge (Leipzig), W. H. Knapp (Hannover), J. Kotzerke (Dresden), T. Kuwert (Erlangen), E. Nitzsche (Aarau), S. N. Reske (Ulm), P. Reuland (Freiburg), H. Schicha (Köln), O. Schober (Münster), M. Schwaiger (München), U. Stabell (Berlin), J. van den Hoff (Dresden-Rossendorf)
Nuklearmedizin 2007; 46: 291–301
Prof. Dr. B. J. Krause
Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität
Ismaninger Str. 22, 81675 München
Tel. 0 89/41 40 29 61
Fax 0 89/41 40 49 50
E-Mail: bernd-joachim.krause@tum.de
Leitlinie: FDG-PET/CT in der Onkologie
B. J. Krause1, T. Beyer2, A. Bockisch2, D. Delbeke3, J. Kotzerke4, V. Minkov5, M. Reiser6, N. Willich7, Arbeitsausschuss Positronenemissionstomographie der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin**
1Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Universität München, 2Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen, 3Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee, USA, 4Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Dresden, 5Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter, 6Institut für Klinische Radiologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, 7Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie – Radioonkologie, Universitätsklinikum Münster, Germany
* Sections of this document were translated and reprinted with permission of the Society of Nuclear Medicine, Procedure Guidelines for Tumor Imaging with 18F-FDG PET/CT: Delbeke D (Chair), Coleman RE, Guiberteau MJ, Brown ML, Royal HD, Siegel BA, Townsend DW, Berland LL, Parker JA, Hubner K, Stabin MJ, Zubal G, Kachelreiss M, Cronin V, Hoolbrook S. Society of Nuclear Medicine Procedure Guidelines for Tumour Imaging using FDG PET/CT. J Nucl Med 2006; 47: 885–895.
** Mitglieder des Arbeitsausschusses PET der DGN (in alphabetischer Reihenfolge): P. Bartenstein (München), R. P. Baum (Bad Berka), W. Burchert (Bad Oeynhausen), U. Haberkorn (Heidelberg), R. Kluge (Leipzig), W. H. Knapp (Hannover), J. Kotzerke (Dresden), T. Kuwert (Erlangen), E. Nitzsche (Aarau), S. N. Reske (Ulm), P. Reuland (Freiburg), H. Schicha (Köln), O. Schober (Münster), M. Schwaiger (München), U. Stabell (Berlin), J. van den Hoff (Dresden-Rossendorf)
Nuklearmedizin 2007; 46: 291–301
| zurück zur Übersicht |
- Zielsetzung
Das Ziel dieser Leitlinie ist es, den Arzt bei der Indikationsstellung, der Durchführung, der Interpretation und der Dokumentation der Ergebnisse einer 18F-Fluordeoxyglukose-Positronenemissionstomographie/Computertomographie-Untersuchung (FDG-PET/CT) bei onkologischen Patienten zu unterstützen.
- Grundlagen und Definitionen
Die Positronenemissionstomographie (PET) ist eine bildgebende Methode zur nicht-invasiven Erfassung und Darstellung metabolischer bzw. funktioneller Zusammenhänge. Die PET beruht auf dem Prinzip der Koinzidenzmessung von Vernichtungsstrahlen aus dem Zerfall von radioaktiven Isotopen (Positronenemittern) in Verbindung mit einem Tracermolekül der Wahl. Mittels der PET können dreidimensional Radioaktivitätsverteilungen in Geweben räumlich erfasst, dargestellt und quantifiziert werden. Bei der FDG-PET wird ein radioaktiv markiertes Glukoseanalogon verwendet. Da die Glukose in Tumoren u. a. durch eine erhöhte Aktivität des Glukosetransporters (Glut I) und der Hexokinase vermehrt verstoffwechselt wird, ist die FDG-PET eine sensitive Methode für
- die Erkennung,
- das Staging und Re-Staging von Tumorerkrankungen sowie
- die Überprüfung des Ansprechens auf Therapien bei vielen Tumorerkrankungen.
Die Computertomographie (CT) ist wie die PET eine tomographische Bildgebungsmethode. Im Unterschied zur Emissionsmessung der PET wird eine externe Transmissionsquelle – eine Röntgenröhre – als Strahlungsquelle verwendet, die in Kombination mit einem gegenüberliegenden Detektorfeld die Messung der Strahlabschwächung durch den Körper ermöglicht. Die CT erlaubt somit die räumlich hoch aufgelöste Darstellung anatomischer bzw. morphologischer Zusammenhänge. Morphologische Bilder erlauben die Detektion pathologischer Prozesse. So werden anatomische Informationen genutzt, um die Lokalisation und die Ausdehnung maligner Erkrankungen mit hoher räumlicher Auflösung zu charakterisieren.
Die FDG-PET und die CT sind klinisch etablierte und validierte diagnostische Methoden. Die gerätetechnische Kombination von PET und CT ermöglicht unmittelbar aufeinander folgende Erfassung von metabolischen (FDG-PET) und morphologischen (CT) Informationen in einem Untersuchungsgang. Obwohl seit den 1980er Jahren verschiedene Methoden zur retrospektiven Koregistrierung von PET- und CT-Bildern verfügbar waren, wurde die PET/CT-Bildgebung erst durch die Verfügbarkeit von kombinierten PET/CT-Tomographen klinisch etabliert. Deren Verwendung wird durch diese Leitlinie behandelt.
Da im Rahmen der PET/CT-Untersuchung sowohl radioaktive Stoffe als auch Röntgenstrahlung zur Anwendung kommen, sind bei einer PET/CT-Untersuchung die Vorschriften der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) bzw. der Röntgenverordnung (RöV) sowie andere einschlägige Rechtsvorschriften, z. B. das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - AMG), das Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz – MPG) und aufgrund dieser Gesetze erlassene Verordnungen zu beachten.
Durch die Kombination beider Methoden in einem Tomographen ergibt sich die Notwendigkeit, die Protokolle der Einzelmethoden aneinander anzupassen. So kann die Verwendung der CT-Daten unter bestimmten Umständen zu Artefakten in den schwächungskorrigierten PET-Bildern führen.
- die Erkennung,
- Definitionen
- Ein kombinierter PET/CT-Tomograph ist eine gerätetechnische Kombination eines PET- und eines CT-Tomographen mit einer integrierten Patientenliege.
- Die kombinierte PET/CT erlaubt die fast gleichzeitige Erfassung von räumlich einander entsprechenden PET- und CT-Untersuchungsbereichen. Beide Datensätze sind intrinsisch bestmöglich koregistriert, da der Patient in beiden Untersuchungen gleich gelagert bleibt.
- Die PET/CT-Fusion ist der Prozess der mechanischen und datentechnischen Überlagerung der in einem Untersuchungsgang erfassten PET- und CT-Bildvolumina in einem fusionierten Datensatz. Im Gegensatz dazu wird in den Leitlinien die retrospektive Koregistrierung von separat erstellten PET- und CT-Daten durch die Schreibweise „PET-CT“ gekennzeichnet.
- Ein PET/CT-Fusionsdatensatz ermöglicht die kombinierte Darstellung der koregistrierten PET- und CT-Datensätze.
- Eine PET/CT-Untersuchung kann den ganzen Körper oder Körperteilbereiche umfassen.
- Die erweiterte Ganzkörper-PET/CT umfasst den gesamten Körper ein schließlich der Schädelkalotte bis zur Fußspitze, was nur in seltenen Fällen medizinisch erforderlich und sinnvoll ist.
- Eine Ganzkörper-PET/CT-Untersuchung umfasst den Körper von der Schädelbasis bis zu den proximalen Oberschenkeln, womit die für die meisten Fragestellungen in der Onkologie relevanten Körperabschnitte erfasst sind.
- Eine Teilbereich-PET/CT-Untersuchung (im onkologischen Kontext) erfasst ein auf das Tumorgeschehen begrenztes Untersuchungsfeld, das in axialer Ausdehnung meistens einer einzelnen Bettposition der PET entspricht.
- Die erweiterte Ganzkörper-PET/CT umfasst den gesamten Körper ein schließlich der Schädelkalotte bis zur Fußspitze, was nur in seltenen Fällen medizinisch erforderlich und sinnvoll ist.
- In PET/CT-Tomographen erfolgt die Absorptions- und Streukorrektur der Emissionsdaten über die erfassten CT-Transmissionsdaten.
- CT-Untersuchungen, die allein zum Zweck der Streu- und Schwächungskorrektur und einer groben anatomischen Zuordnung mit z. B. reduziertem Röhrenstrom und reduzierter Röhrenspannung durchgeführt werden, bezeichnet man als „low-dose“ bzw. „Niedrigdosis-CT“.
- Ein diagnostisches CT beruht auf der radiologischen Praxis entnommenen Untersuchungsparametern; meist in Verbindung mit der intravenösen Gabe von iodhaltigen CT-Kontrastmitteln und Verwendung von Ateminstruktionen.
- Ein diagnostisches CT wird z. B. gewählt, wenn die PET/CT-Untersuchung eine separate CT-Untersuchung ersetzt oder anderweitige Gründe bestehen, die diagnostische Wertigkeit der CT-Untersuchung in vollem Umfang auszuschöpfen.
- Ein diagnostisches CT beruht auf der radiologischen Praxis entnommenen Untersuchungsparametern; meist in Verbindung mit der intravenösen Gabe von iodhaltigen CT-Kontrastmitteln und Verwendung von Ateminstruktionen.
- Ein kombinierter PET/CT-Tomograph ist eine gerätetechnische Kombination eines PET- und eines CT-Tomographen mit einer integrierten Patientenliege.
- Anwendungen: Beispiele und Forschung
Im Folgenden sind Anwendungsbeispiele wiedergegeben, wobei es nicht das Ziel dieser Leitlinie ist, den Evidenzgrad einzelner Indikationen aufzuzeigen:
- Unterscheidung von benignen und malignen Läsionen (z. B. unklarer Lungenrundherd),
- Suche nach einem unbekannten Primärtumor, wenn eine Metastasierung als erste Tumormanifestation entdeckt wird oder ein paraneoplastisches Syndrom vorliegt,
- Staging eines bekannten Tumorleidens,
- Überprüfung des Therapieansprechens bei bekanntem Tumorleiden,
- Beurteilung des Vorliegens residueller Tumorerkrankung (vitales Tumorgewebe vs. Narbengewebe), wenn dieses bei der körperlichen Untersuchung oder durch andere bildgebende Verfahren nicht unterschieden werden kann bzw. der Verdacht darauf besteht,
- Ermittlung eines Tumorrezidivs, insbes. bei steigender Tumormarkerkonzentration,
- Selektion einer geeigneten Stelle des Tumors für eine Biopsie,
- Hilfe bei der Strahlentherapieplanung,
- nicht onkologische Fragestellungen (z. B. Infektion oder Artherosklerose).
- Unterscheidung von benignen und malignen Läsionen (z. B. unklarer Lungenrundherd),
- Durchführung der FDG-PET/CT-Untersuchung
- Patientenvorbereitung
Die wesentlichen Ziele der Patientenvorbereitung sind die Reduktion der Traceraufnahme im Normalgewebe (z. B. Herzmuskel, Skelettmuskulatur) bei Erhaltung der Traceraufnahme in den Zielgewebsstrukturen (Tumorgewebe). Im Folgenden ist ein allgemein Verwendung findendes Protokoll aufgeführt:
- Im Fall von Schwangerschaft und Stillzeit einer Patientin: siehe Leitlinie nuklearmedizinische Bildgebung (AWMF-Leitlinien-Register 031/030)
- Vor der Durchführung der FDG-PET/CT Untersuchung: Patienten werden instruiert, dass sie vier bis sechs Stunden vor der Applikation von FDG nicht essen und keine Getränke zu sich nehmen sollen (ausgenommen Wasser), um den physiologischen Blutzuckerspiegel zu senken und einen niedrigen Seruminsulinspiegel zu erreichen. Eine ausreichende Hydrierung wird empfohlen. Eine parenterale Ernährung oder glukosehaltige Infusionen müssen ebenfalls vier bis sechs Stunden vor der Tracerapplikation abgesetzt werden.
Wenn ein diagnostisches CT mit Verwendung iodhaltiger Kontrastmittelapplikation vorgesehen ist, müssen die dafür geltenden Kontraindikationen und Einschränkungen beachtet werden, insbesondere ist zu klären, ob eine Überempfindlichkeit gegen iodhaltige Kontrastmittel vorliegt, ein Metformin enthaltendes Präparat eingenommen wird oder eine Nierenschädigung besteht. Intravenöse iodhaltige Kontrastmittel sollten bei einem erhöhten Kreatininspiegel nicht verabreicht werden, bzw. es sollten prophylaktische Maßnahmen zur Prävention einer Kontrastmittel-induzierten Nephropathie ergriffen werden (Adolph et al. 2005).
- Vor der Injektion von FDG
- Für eine Untersuchung des Gehirns erfolgt die FDG-Injektion beim liegenden Patienten in einem stillen und abgedunkelten Raum, in dem der Patient nach der Injektion bis zum Start der PET/CT-Untersuchung auch verbleibt.
- Für die FDG-Injektion sollte der Patient für und während der Verteilungsphase ruhig und entspannt sitzen oder liegen ohne zu sprechen, um eine erhöhte muskuläre Aufnahme zu vermeiden.
- Der Blutglukosespiegel wird vor der FDG-Injektion bestimmt. Bei Hyperglykämie kann die FDG-Aufnahme in den Tumor erniedrigt sein. Wenn der Glukosespiegel über 150–200 mg/dl liegt, sollte die Untersuchung – wenn möglich – zu einem späteren Zeitpunkt nach erneuter Kontrolle des Glukosespiegels durchgeführt oder der Patient erneut einbestellt werden. Eine Insulingabe zur Senkung des Glukosespiegels kann erwogen werden, aber die Injektion von FDG darf erst nach einem Zeitintervall (bei erwartungsgemäß bereits wieder steigendem Glukosespiegel) vorgenommen werden, das vom verwendeten Insulin und der Art der Gabe abhängig ist und durch Messung des Blutzuckers kontrolliert werden sollte.
- Solange keine medizinische Kontraindikation besteht, kann ein intraluminales Kontrastmittel für gastrointestinale Untersuchungen verabreicht werden, um eine bessere Darstellung der intestinalen Strukturen in der CT zu erreichen (Negativ-Kontrast). Bei diagnostischem CT wird empfohlen, ein orales Kontrastmittel zu applizieren (siehe Protokoll für die CT-Bildgebung).
- Der Patient muss alle Metallgegenstände ablegen.
- In allen Fällen sollte der Patient die Blase vor Beginn der Untersuchung leeren, um die Strahlenexposition für die Blase und das harnableitende System zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern.
- Für eine Untersuchung des Gehirns erfolgt die FDG-Injektion beim liegenden Patienten in einem stillen und abgedunkelten Raum, in dem der Patient nach der Injektion bis zum Start der PET/CT-Untersuchung auch verbleibt.
- Im Fall von Schwangerschaft und Stillzeit einer Patientin: siehe Leitlinie nuklearmedizinische Bildgebung (AWMF-Leitlinien-Register 031/030)
- Notwendige Patienteninformationen
- Im Vorfeld der FDG-PET/CT-Untersuchung sollen folgende Informationen vom Patienten erhoben werden: Auf die Fragestellung fokussierte Krankengeschichte: Art und Lokalisation der malignen Erkrankung, Datum der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Behandlung vor der aktuellen FDG-PET/CT-Untersuchung (z. B. Biopsieergebnisse und -zeitpunkt, Histologie, Operation/-en, Strahlentherapie, Chemotherapie, Gabe von knochenmarksstimulierenden Medikamenten und Steroiden) und Medikation zum Zeitpunkt der Untersuchung, Voruntersuchungen (insbesondere PET/CT).
- Diabetes mellitus in der Anamnese, letzte Nahrungsaufnahme, nicht lange zurückliegende Infektions- oder Erkältungserkrankungen,
- Fähigkeit des Patienten, für die Dauer der Untersuchung still zu liegen (25–45 min); insbesondere die Arme für die Zeitdauer der Untersuchung über den Kopf zu nehmen.
- Klaustrophobie: Fähigkeit des Patienten, für die Dauer der Untersuchung im PET/CT-Tomographen zu verbleiben (Tunneldurchmesser 60–70 cm).
- Im Vorfeld der FDG-PET/CT-Untersuchung sollen folgende Informationen vom Patienten erhoben werden: Auf die Fragestellung fokussierte Krankengeschichte: Art und Lokalisation der malignen Erkrankung, Datum der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Behandlung vor der aktuellen FDG-PET/CT-Untersuchung (z. B. Biopsieergebnisse und -zeitpunkt, Histologie, Operation/-en, Strahlentherapie, Chemotherapie, Gabe von knochenmarksstimulierenden Medikamenten und Steroiden) und Medikation zum Zeitpunkt der Untersuchung, Voruntersuchungen (insbesondere PET/CT).
- Vorsichtsmaßnahmen
Siehe Leitlinie nuklearmedizinischer Bildgebung (AWMF-Leitlinien-Register 031/030).
- Strahlenexposition
Bei der PET/CT ergibt sich die Strahlenexposition des Patienten aus der Summe der Strahlenexposition des PET-Radiopharmazeutikums und der Strahlenexposition durch die CT. Insbesondere für Kinder, aber auch bei Erwachsenen ist die gesamte Strahlenexposition einer kombinierten PET/CT-Untersuchung im Kontext der diagnostischen Fragestellung zu sehen.
In den vergangenen Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, die mit einer konventionellen CT- oder PET-Untersuchung verknüpfte Strahlenexposition so weit wie möglich zu begrenzen. Hierzu gehören u. a. die Definition von Qualitätskriterien für die CT sowie die Festlegung von diagnostischen Referenzwerten. Allerdings können die zurzeit in Deutschland für Messungen an konventionellen PET-Tomographen mit BGO-Blockdetektoren festgelegten diagnostischen Referenzwerte für FDG-PET nicht a priori auf PET/CT-Untersuchungen übertragen werden, da die Optimierung von kombinierten PET/CT-Untersuchungen im Hinblick auf den gesamten Untersuchungsablauf erfolgen muss und nicht isoliert für die Einzeluntersuchungen. Entsprechend einer PET/CT-Multicenter-Studie in Deutschland werden üblicherweise Aktivitäten zwischen 300 MBq und 400 MBq FDG verwendet.
Die Strahlenschutzkommission ist in einer aktuellen Empfehlung zu dem Schluss gekommen, dass eine Aktivität von 350 MBq FDG für die PET/CT-Untersuchung bei einem normalgewichtigen Patienten (70 kg) angemessen ist, da die Aussagekraft der
PET/CT wesentlich von der präzisen Koregistrierung der beiden Untersuchungen abhängt und die PET-Untersuchung nicht unnötig durch die Applikation geringer Aktivitätsmengen verlängert werden sollte. Die effektive Dosis infolge i.v.-Applikation von 350 MBq FDG beträgt gemäß Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee 6,7 mSv.
Die Strahlenexposition infolge einer CT-Untersuchung im Rahmen der PET/CT ist vom Zweck der CT-Untersuchung abhängig und kann sehr unterschiedlich sein: Das CT kann als Low-dose-CT (d. h., mit geringem Röhrenstrom und evtl. niedriger Röhrenspannung) aufgenommen und allein zur Schwächungskorrektur der Emissionsdaten und zur groben anatomischen Orientierung verwendet werden. Alternativ kann das CT als diagnostisches CT mit/ohne Kontrastmittel durchgeführt und für eine umfassendere Diagnose verwendet werden. Die effektive Dosis von Low-dose- bzw. diagnostischen CTs liegt nach der Multicenter-Studie im Rahmen von 1–3 mSv bzw. 14–18 mSv, kann aber in Ausnahmefällen darüber liegen. Angesichts der Vielfalt der CT-Protokolle und -Systeme sollte die Strahlenexposition durch eine PET/CT-Untersuchung für jedes verwendete System und Protokoll separat abgeschätzt werden.
PET/CT-Untersuchungen sind für den einzelnen Patienten mit einer vergleichsweise hohen Strahlenexposition verbunden, so dass sie einer sorgfältigen Rechtfertigung und Optimierung bedürfen, um Wiederholungsuntersuchungen bzw. unnötig hohe Strahlenexpositionen zu vermeiden. Die Wahl eines geeigneten Untersuchungsprotokolls hängt von der klinischen Fragestellung ab und muss daher gemeinsam vom fachkundigen Nuklearmediziner und Radiologen im Rahmen der rechtfertigenden Indikation in jedem Einzelfall festgelegt werden. Im Interesse des Strahlenschutzes muss der retrospektiven Bildfusion vor der Durchführung einer PET/CT mit diagnostischem CT der Vorrang gegeben werden, wenn bereits eine geeignete PET- bzw. eine morphologische Schnittbilduntersuchung vorliegt und wenn dabei eine ausreichende diagnostische Aussage erzielt werden kann.
Zur Optimierung von PET/CT-Untersuchungen sollten möglichst Dosisreduktionstechniken eingesetzt werden, von denen einige direkt aus der konventionellen CT-Praxis übernommen werden können. Die Durchführung einer diagnostischen CT-Untersuchung zum ausschließlichen Zweck der Schwächungskorrektur der Emissionsdaten ist nicht gerechtfertigt.
- Datenakquisition
Betrieb des PET und CT: Richtlinien
Positronenemissionstomographie (PET): Bei der Bildakquisition sind die für Deutschland geltenden Richt- und Leitlinien zu beachten, z. B. die AWMF-Leitlinie „Tumordarstellung mit (18F)-Fluordeoxyglukose (FDG)“ (AWMF-Leitlinien-Register 031/028). Darüber hinaus können die „PET tumor imaging guidelines“ der Society of Nuclear Medicine zu Rate gezogen werden.
Computertomographie (CT): Auch bei der Bildakquisition für die CT sind die für Deutschland geltenden Richt- und Leitlinien zu beachten. Für Bildakquisition und Bildqualität der CT maßgebend sind die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über „Kriterien zur Qualitätssicherung in der radiologischen Diagnostik gemäß § 136 SGB V“ in der Fassung vom 17. Juni 1992, zuletzt geändert am 17. Dezember 1996. Außerdem sind die „Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie (Beschlüsse des Vorstands der Bundesärztekammer vom 10. April 1992)“ zu berücksichtigen. Darüber hinaus können die entsprechenden Spezifikationen und Leitlinien des American College of Radiology zu Rate gezogen werden.
- Patientenlagerung
Positionierung und Gesichtsfeld
- Für die meisten onkologischen Fragestellungen ist eine PET/CT-Untersuchung des Ganzkörpers (Schädelbasis bis Mitte Oberschenkel) ausreichend.
- Erweiterte Ganzkörperuntersuchungen werden bei Tumoren mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine Metastasierung in Kopf, Schädel, Hirn, Kopfhaut und unteren Extremitäten durchgeführt.
- Teilbereichsuntersuchungen können bei Verlaufsuntersuchungen erwogen werden, wenn die Erkrankung nur eine bestimmte anatomische Region betrifft (z. B. solitärer Lungenrundherd, Verdacht auf Lungenkarzinom, Untersuchung hilärer Lymphknoten, Diagnostik bei Kopf- und Halstumoren, Überprüfung des Therapieansprechens).
- Der Patient sollte mit den Armen über dem Kopf gelagert werden. Wird das vom Patienten nicht toleriert, kann auch ein Arm über dem Kopf, der andere am Körper gelagert werden. Ziel ist es in jedem Fall, Strahlenaufhärtungsartefakte im Bereich des Körperstamms sowie Bildartefakte durch transversale Gesichtsfeldüberschreitungen zu vermeiden.
- Bei der Untersuchung von Kopf- und Halstumoren wird ein zweigeteiltes Protokoll (Körperstamm vom Lungenapex bis zum Oberschenkel und Kopf-Hals-Bereich) empfohlen, bei dem die jeweiligen Akquisitions- und Rekonstruktionsparameter an das Untersuchungsareal angepasst werden. Ein ausgedehntes Körperstammprotokoll mit am Körper gelagerten Armen ist ebenfalls möglich.
- Werden die FDG-PET/CT-Bilddaten zur Bestrahlungsplanung genutzt, sollte die Untersuchung in Bestrahlungslagerung durchgeführt werden. Dafür sind spezielle, radioopaque Lagerungshilfen verfügbar.
- Für die meisten onkologischen Fragestellungen ist eine PET/CT-Untersuchung des Ganzkörpers (Schädelbasis bis Mitte Oberschenkel) ausreichend.
- Protokoll für die CT-Bildgebung:
Der CT-Teil einer PET/CT-Untersuchung umfasst das Topogramm (Übersichts-Scan) und die Spiral-CT-Untersuchung. Letztere kann in der gewählten Dosis stark variieren – man spricht dann von einem „Niedrigdosis-CT“ und einem diagnostischen CT. Ersteres wird für eine Streu-/Absorptionskorrektur und zur anatomischen Zuordnung sowie für die Erkennung von pathologischen Veränderungen verwendet, die im nativen CT-Bild mit niedriger Dosis trotz des vermehrten Bildrauschens nachweisbar sind. Ein diagnostisches CT wird bei Bedarf einer hoch-qualitativen und diagnostisch umfassenderen PET/CT-Untersuchung gewählt. In bestimmten Fällen wird ein Niedrigdosis-CT für die Absorptionskorrektur sowie ein diagnostisches CT (nach der PET-Datenakquisition) durchgeführt. Die Optimierung der CT-Protokolle im Rahmen der PET/CT-Untersuchung ist ein fortlaufender Prozess:
- Wenn eine CT allein für die Absorptionskorrektur durchgeführt wird, werden die Untersuchungsparameter (Röhrenstrom, Röhrenspannung, Schichtdicke, Tischvorschub) so gewählt, dass die Strahlenexposition für den Patienten minimal ist.
- Für ein diagnostisches CT existieren standardisierte Akquisitionsparameter. Eine Modulation des Röhrenstroms kann zur Reduzierung der Strahlenexposition des Patienten eingesetzt werden. Abhängig von der jeweiligen klinischen Fragestellung kommen intravenöse oder/und orale Kontrastmittel zur Anwendung. Es kann auch sinnvoll sein, ein diagnostisches CT nur für einen begrenzten Körperabschnitt durchzuführen, während in den übrigen Körperabschnitten ein Niedrigdosis-CT zur Schwächungskorrektur bzw. zur anatomischen Zuordnung erfolgt. Werden bei der CT-Untersuchung hohe intra-vaskuläre Konzentrationen von intravenösem Kontrastmittel erfasst, führen diese durch die CT-basierte Absorptionskorrektur zu Artefakten und einer quantitativ falschen Bestimmung der Tracerkonzentration, was zu vermeiden bzw. zu korrigieren ist.
- Orale CT-Kontrastmittel sind nicht kalorische, intraluminale Kontrastmittel, die mit dem Ziel einer verbesserten Abgrenzung des Gastrointestinaltrakts verabreicht werden. Man unterscheidet positive Kontrastmittel (verdünntes Bariumsulfat, iodhaltiges Kontrastmittel) und negative Kontrastmittel (z. B. Wasser). Ansammlungen von hochkonzentrierten barium- oder iodhaltigen Kontrastmitteln können – bei Verwendung des CT zur Absorptionskorrektur – zu Artefakten im Sinne einer Überschätzung der regionalen FDG-Akkumulation führen. Diese Artefakte werden durch Verwendung negativer oraler Kontrastmittel vermieden. Die alleinige Applikation von Wasser als oralem Kontrastmittel ist infolge seiner raschen Resorption ungünstig und kann auch vermehrt zu unspezifischer FDG-Anreicherung im Darm führen. Günstiger ist deshalb die Verwendung einer Mannitlösung (z. B. 2,5 g Mannit auf einen Liter Wasser), durch die die Wasserresorption aus dem Darm deutlich verringert wird.
- Bei PET/CT-Untersuchungen kommt der Atembeweglichkeit des Thorax und des Zwerchfells eine besondere Bedeutung zu. Obwohl ein CT des Thorax üblicherweise in Inspiration akquiriert wird, ist dies nicht optimal für eine PET/CT-Untersuchung, da es zu einer relevanten Fehlregistrierung insbesondere im Bereich der anterioren Thoraxwand und der oberen Zwerchfellkuppe führt. Teilweise werden CT-Transmissionsaufnahmen in inspiratorischer Mittellage und Luftanhalten durchgeführt, oder dem Patienten ist es während der CT-Untersuchung erlaubt, flach zu atmen. Respiratorische Bewegungsveränderungen führen zu einer ungenauen Lokalisation von Befunden – insbesondere an der Lungenbasis und in der Lungenperipherie, im Bereich der Leber und in der Nähe von Lungen-Weichteilgewebe-Übergängen – sowie zu einer verfälschten SUV-Bestimmung von Läsionen. Bewegungskorrekturen oder respiratorische Atemtriggerung werden empfohlen, soweit vorhanden und einsetzbar.
- Wenn eine CT allein für die Absorptionskorrektur durchgeführt wird, werden die Untersuchungsparameter (Röhrenstrom, Röhrenspannung, Schichtdicke, Tischvorschub) so gewählt, dass die Strahlenexposition für den Patienten minimal ist.
- Protokoll für die PET-Emissionsbildgebung:
- PET-Emissionsbilder sollten frühestens 60 min nach der Injektion des Radiopharmazeutikums akquiriert werden. Häufig wird die Akquisition der PET-Emissionsdaten auch erst 90 min nach Injektion von FDG begonnen. Die Zeit zwischen der FDG-Injektion und der Bilddatenakquisition sollte in jedem Fall standardisiert gehalten werden, insbesondere dann, wenn semiquantitative Parameter wie standardisierte Aufnahmewerte (SUV-Werte) im Verlauf der Therapie verglichen werden sollen.
- Die Akquisitionszeit für Emissionsbilder variiert in der Regel von 2 min bis 5 min pro Bettposition, abhängig von dem Wohlbefinden des Patienten, der applizierten Aktivität, dem Körpergewicht des Patienten und der Sensitivität der Detektoren. Die durchschnittliche Akquisitionszeit für eine Körperstamm FDG-PET/CT beträgt zurzeit 15–30 min. Die Akquisitionszeit kann bei Bedarf (Wohlbefinden des Patienten, geforderte Bildqualität) angepasst werden.
- Die semiquantitative Bestimmung des Glukosestoffwechsels unter Verwendung von SUV-Werten basiert auf relativen Läsionsaktivitätskonzentrationen, die auf schwächungskorrigierten Bildern nach Normalisierung für die injizierte Aktivität und Körpergewicht, Body-mass-Index (BMI) oder Körperoberfläche ermittelt werden. Diese Messungen werden auf der Basis eines statischen Emissionsbilds vorgenommen. Die Genauigkeit der SUV-Bestimmung hängt u. a. von der Genauigkeit der Kalibrierung des Positronenemissionstomographen ab. Die Reproduzierbarkeit der SUV-Messungen wird durch die Reproduzierbarkeit der klinischen Protokolle beeinflusst (z. B. Zeit der Emissionsbilder-Akquisition nach FDG-Injektion, verwendeter Rekonstruktionsalgorithmus, Art der Schwächungskorrektur, Größe der ROI, Analysemethode – Maximum oder Mittelwert).
- Semiquantitative Bestimmungen des Tumormetabolismus können ebenfalls auf der Basis eines Quotienten der FDG-Aufnahme in der Läsion zur FDG-Aufnahme in einer Referenzregion (Blutpool, Mediastinum, Leber, Zerebellum) vorgenommen werden.
- PET-Emissionsbilder sollten frühestens 60 min nach der Injektion des Radiopharmazeutikums akquiriert werden. Häufig wird die Akquisition der PET-Emissionsdaten auch erst 90 min nach Injektion von FDG begonnen. Die Zeit zwischen der FDG-Injektion und der Bilddatenakquisition sollte in jedem Fall standardisiert gehalten werden, insbesondere dann, wenn semiquantitative Parameter wie standardisierte Aufnahmewerte (SUV-Werte) im Verlauf der Therapie verglichen werden sollen.
- Interventionen
- Eine intensive Aktivitätskonzentration in der Blase kann die Interpretation von Befunden im Becken erschweren. Hydrierung und die Gabe eines Schleifendiuretikums sind Möglichkeiten, um die Blasenaktivität (und Strahlenexposition) zu reduzieren. Für spezielle Fragestellungen kann eine Blasenkatheterisierung mit einem 3-Wege-Spülkatheter nach der Injektion bis zum Zeitpunkt der Bildgebung verwendet werden, um störende Aktivität in der Blase zu eliminieren.
- Der Aufenthalt des Patienten in einem warmen Raum (oder mit lokaler Erwärmung) 30–60 min vor der FDG-Injektion hilft, Anreicherungen im braunen Fettgewebe zu reduzieren; insbesondere in Gebäuden mit Klimatisierung. Lorazepam oder Diazepam reduzieren ebenso wie b-Rezeptorenblocker – wenn rechtzeitig vor der Injektion gegeben – die FDG-Aufnahme ins braune Fettgewebe.
- Eine intensive Aktivitätskonzentration in der Blase kann die Interpretation von Befunden im Becken erschweren. Hydrierung und die Gabe eines Schleifendiuretikums sind Möglichkeiten, um die Blasenaktivität (und Strahlenexposition) zu reduzieren. Für spezielle Fragestellungen kann eine Blasenkatheterisierung mit einem 3-Wege-Spülkatheter nach der Injektion bis zum Zeitpunkt der Bildgebung verwendet werden, um störende Aktivität in der Blase zu eliminieren.
- Patientenvorbereitung
- Datenauswertung
- CT-Rekonstruktion
Die während der PET/CT-Untersuchung durchgeführten CT-Transmissionsmessungen werden mittels gefilterter Rückprojektion in CT-Bilder rekonstruiert. Je nach Wahl des CT-Protokolls und der diagnostischen Fragestellung werden separate Rekonstruktionen für den Fall der PET-Schwächungskorrektur sowie für eine eventuelle CT-gesteuerte Befundung durchgeführt. Diese Rekonstruktionen unterscheiden sich in der Schichtdicke, Schichtüberlappung, Filter u.a. Zusätzlich zu dem Rekonstruktionskernel, der die Bildcharakteristika innerhalb der Schichten moduliert (z. B. räumliche Auflösung, Kantenbetonung und Rauscheigenschaften), wird eine longitudinale Filterung (in z-Richtung) verwendet, um die Auflösung in z-Richtung und die Schichtsensitivitätsprofile zu modifizieren. Die gemessenen Schwächungswerte für jeden Bildpunkt werden auf die Dichte von Wasser normiert
CT-Wert = HU = 1000 (µ – µWasser)
µWasser
und so jedem Voxel bei der Bildrekonstruktion ein geräteunabhängiger Zahlenwert zugeordnet. Durch dieses Verfahren wird zudem die Abhängigkeit der Schwächungswerte von der Strahlenenergie herabgesetzt.
In modernen CT-Tomographen nähert sich die Auflösung in z-Richtung der transversalen Auflösung an, und nahezu isotrope Voxel erlauben Bilddarstellungen in koronarer oder sagittaler Schichtführung mit ebenfalls hoher Qualität. Zusätzliche Nachverarbeitungen wie das „Volume rendering“ oder die Maximum-Intensitätsprojektion (MIPs) profitieren von der hohen Qualität der Bilddaten.
- PET-Daten-Rekonstruktion
Die Emissionsdaten müssen für geometrisches Ansprechen und Detektoreffizienz (Normalisierung), Systemtotzeit, zufällige Koinzidenzen, Streuung, und Schwächung korrigiert werden. Einige dieser Korrekturen (z. B. Schwächungskorrektur) können direkt in den Rekonstruktionsvorgang einbezogen werden. Im 3D-Modus akquirierte Daten können entweder in 2D-Daten umsortiert und mit einem 2D-Rekonstruktionsalgorithmus oder direkt mit einem 3D-Algorithmus rekonstruiert werden.
Iterative Rekonstruktionsverfahren sind für klinische Fragestellungen inzwischen weitgehend Standard und haben die gefilterten Rückprojektionsmethoden zur Rekonstruktion der Daten ersetzt. Es entspricht mittlerweile guter klinischer Praxis, Rekonstruktionen mit und ohne Schwächungskorrektur durchzuführen, um potenzielle Rekonstruktionsartefakte durch eine CT-basierte Schwächungskorrektur zu erfassen. Zur Befundung wird der rekonstruierte 3D-Volumendatensatz in transaxialen, koro-nalen und sagittalen Schichten sowie in einer Maximum-Intensitätsprojektion visualisiert.
- Bilddatendarstellung
Die mit integrierten PET/CT-Systemen assoziierten Befundungs-Softwarepakete ermöglichen die Darstellung der PET-, CT- und PET/CT-Fusionsbilder in allen drei Hauptachsen, sowie von Maximum-Intensitäts-Projektionen zur Übersichtsdarstellung in einem 3D-Rotations (Cine) Modus. FDG-PET-Bilder mit und ohne Absorptionskorrektur sind ebenfalls darstellbar. Auf allen Schnittbildern (nach Absorptionskorrektur) können quantitative Aussagen hinsichtlich der Größe und Traceranreicherung gewonnen werden.
- Interpretationskriterien
- Untersuchungskennzeichnung,
- klinische Informationen:
- rechtfertigende Indikation für die Untersuchung,
- untersuchungsrelevante anamnestische Informationen,
- abrechnungsrelevante Informationen,
- rechtfertigende Indikation für die Untersuchung,
- Untersuchungsablauf und Bildgebungsprotokoll:
- Radiopharmazeutikum mit applizierter Aktivität, Injektionsart, ggf. Lokalisationsangabe der Injektion, Zeitpunkt der Injektion und Einwirkzeit von FDG (auch: uptake time), Körpergewicht des Patienten,
- Angabe von Medikamenten, die verabreicht wurden, wie z. B. Gabe von Furosemid (Dosierung und Zeitpunkt), Muskelrelaxantien, Schmerzmedikation und Sedierung (kurze Beschreibung des Vorgangs, Angabe der Medikation und des Zeitpunkts in Bezug auf die Injektion des Radiopharmazeutikums; Dokumentation des Zustands des Patienten zum Zeitpunkt der Sedierung und am Ende der FDG-PET/CT-Studie),
- Gesichtsfeld und Patientenpositionierung: Ganzkörper-, Körperstamm- oder Teilbereich PET/CT; Position der Arme,
- Blutglukosespiegel vor der Untersuchung,
- CT-Untersuchungsprotokoll: Niedrigdosis-CT und/oder diagnostisches CT, Kontrastmittelgaben (oral, intravenös, mit Volumen- und Konzentrationsangabe, nativ, arteriell, portalvenös) mit Angabe des klinischen Kontexts, untersuchte Region,
- Radiopharmazeutikum mit applizierter Aktivität, Injektionsart, ggf. Lokalisationsangabe der Injektion, Zeitpunkt der Injektion und Einwirkzeit von FDG (auch: uptake time), Körpergewicht des Patienten,
- Befundbeschreibung:
- Qualität der Studie: z. B. limitiert aufgrund von Bewegungsartefakten, Aufnahme von FDG in Muskulatur oder braunes Fettgewebe, Hyperglykämie, CT-Artefakte, hohes Patientengewicht,
- Beschreibung der Lokalisation, der Ausdehnung und der Intensität pathologischer FDG-Anreicherungen in Bezug zu normalem Gewebe und Beschreibung der relevanten morphologischen Befunde in der CT sowie in Bezug auf die pathologischen FDG-Anreicherungen. Ein quantitativer Parameter zur Abschätzung der FDG-Aufnahme ist der SUV. Trotzdem sollte die Anreicherung als schwach, mäßig intensiv oder intensiv im Vergleich zur Hintergrundaufnahme im Leberparenchym (mittlerer SUV: 2.0–3.0; maximum SUV: 3.0–4.0) eingeschätzt werden. Der PET/CT-Bericht muss alle im CT-Teil der Untersuchung diagnostizierten Befunde beinhalten, außer die CT-Komponente wird nur zur Schwächungskorrektur durchgeführt.
- Limitationen: Wenn erforderlich, sollten Faktoren, die die Sensitivität und Spezifität der Untersuchung beeinflussen, angegeben werden (kleine Läsionen oder entzündliche Veränderungen, Muskelaktivität, hoher Blutzuckerspiegel zum Zeitpunkt der Injektion).
- Klinischer Kontext: Adressierung und Beantwortung aller klinischen Fragestellungen im Kontext der Anforderung der Untersuchung,
- vergleichende Daten: Der Vergleich mit vorangegangenen Untersuchungen und Berichten sollte – wenn möglich – Teil des Untersuchungsberichts sein. PET/CT-Studien sind in ihrer diagnostischen Aussagekraft wertvoller, wenn sie mit vorhergehenden bildgebenden Untersuchungen (z. B. CT, PET, PET/CT, MRT) sowie weiteren relevanten klinischen Daten in Bezug gesetzt werden. Wenn eine PET/CT-Untersuchung zur Überprüfung eines Therapieansprechens durchgeführt wird, sollte das Ausmaß und die Intensität der FDG-Aufnahme zusammengefasst werden als metabolisch fortschreitende Erkrankung (auch: progressive disease), stabile Erkrankung (auch: stable disease), als partielles Therapieansprechen (auch: partial response) oder Therapieansprechen (auch: complete response). Die European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) hat Kriterien für die Beurteilung des Therapieansprechens publiziert. Eine Angabe der Änderung der Intensität der Anreicherung mit semiquantitativen Parametern, ausgedrückt als Absolutwerte oder in prozentualer Änderung, kann für bestimmte klinische Fragestellungen angemessen sein. Es muss aber auf Vergleichbarkeit geachtet werden hinsichtlich des technischen Protokolls und der Bilddatenanalyse wie dargelegt.
- Qualität der Studie: z. B. limitiert aufgrund von Bewegungsartefakten, Aufnahme von FDG in Muskulatur oder braunes Fettgewebe, Hyperglykämie, CT-Artefakte, hohes Patientengewicht,
- Zusammenfassende Beurteilung und Diagnose:
- Wenn möglich, sollte eine eindeutige Diagnose gestellt werden, zumindest aber der Grad der Wahrscheinlichkeit einer Diagnose angegeben werden.
- Wenn angemessen, sollten relevante Differenzialdiagnosen angegeben werden.
- Wenn angemessen, sollten ggf. Verlaufs- und/oder zusätzliche Untersuchungen empfohlen werden, um Befunde zu klären oder zu bestätigen.
- Wenn möglich, sollte eine eindeutige Diagnose gestellt werden, zumindest aber der Grad der Wahrscheinlichkeit einer Diagnose angegeben werden.
- Untersuchungskennzeichnung,
- FDG-PET/CT zur Bestrahlungsplanung
Die Verwendung von PET/CT-Datensätzen kann ein geeignetes Verfahren zur optimalen Zielvolumendefinition für die Bestrahlungsplanung darstellen (z. B. beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom). Die Einbeziehung von PET/CT in die Bestrahlungsplanung setzt eine enge Kooperation von Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Radiologie voraus. Die Verantwortung für die Verwendung des PET/CT-Datensatzes für die Bestrahlungsplanung liegt beim Strahlentherapeuten. Eine wichtige Voraussetzung für die Bestrahlungsplanung ist die Durchführung der FDG-PET/CT-Untersuchung in Bestrahlungsposition, also unter Verwendung spezifischer strahlentherapeutischer Lagerungshilfen (Lagerungstisch, Masken, etc.). Weiterhin muss zur exakten Positionierung ein Raumlaser am PET/CT vorhanden sein. Neben der Patientenlagerung legt der Strahlentherapeut die für die Bestrahlungsplanung erforderlichen CT-Parameter fest (z. B. Schichtdicke und Atemprotokoll). Sämtliche Schritte von der Datenakquisition bis zur Umsetzung des Bestrahlungsplans am Patienten bedürfen der medizinischen und physikalischen Qualitätssicherung durch alle beteiligten Disziplinen einschließlich der jeweilig zuständigen Medizinphysikexperten. Die Interpretation der Befunde zur Festlegung des Zielvolumens unter Verwendung der FDG-PET/CT-Daten erfolgt interdisziplinär.
- CT-Rekonstruktion
- Qualitätskontrolle
- Radiopharmazeutika
Für die Qualitätskontrolle bei Radiopharmazeutika wird auf die „Draft Guidelines for Radiopharmacy“ der EANM verwiesen: Eur J Nucl Med Mol Imag 2003; 30: BP63 – BP72.
Instrumentierung
PET: Es werden Geräte mit einer allgemeinen Bauartzulassung verwendet.
CT: Es werden Geräte mit einer allgemeinen Bauartzulassung verwendet und die Inbetriebnahme erfolgt im Anzeigeverfahren gemäß RöV.
- Leistungsspezifikationen: Tomographen für Patientenuntersuchungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- CT: Die Spezifikationen basieren auf herstellerspezifischen Angaben in Übereinstimmung mit dem MPG.
- PET- und PET/CT-Tomographen: Die Spezifikationen basieren auf herstellerspezifischen Angaben.
Beim PET/CT sollte das gemessene CT-Gesichtsfeld mindestens 50 cm im Durchmesser haben. Eine Workstation mit der Möglichkeit der Darstellung von PET-, CT- und fusionierten Bildern mit frei wählbarer PET- und CT-Überblendung muss vorhanden sein. Die Workstation sollte eine multiplanare Darstellung mit einem gekoppelten PET- und CT-Cursor erlauben. Eine retrospektive Ko-Registrierung der PET/CT -Datensätze mit anderen Datensätzen (z. B. MR, CT, SPECT) sollte möglich sein.
- CT: Die Spezifikationen basieren auf herstellerspezifischen Angaben in Übereinstimmung mit dem MPG.
- Qualitätskontrolle der Geräte:
- Die PET-Qualitätskontrolle muss in Übereinstimmung mit der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin erfolgen. Angaben zur praktischen Durchführung finden sich in der DIN 6855–4.
- Der Betrieb und die Qualitätskontrollen in der Computertomographie unterliegen den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über Kriterien zur Qualitätssicherung in der radiologischen Diagnostik gemäß § 136 SGB V in der Fassung vom 17. Juni 1992, zuletzt geändert am 17. Dezember 1996. Außerdem maßgeblich sind die Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Computertomographie – aufgrund der Beschlüsse des Vorstands der Bundesärztekammer vom 10. April 1992.
- Die Qualitätskontrolle eines PET/CT-Tomographen sollte die Anforderungen für beide (PET- und CT-)Tomographen – gemäß oben genannter Quellen umfassen.
- Die PET-Qualitätskontrolle muss in Übereinstimmung mit der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin erfolgen. Angaben zur praktischen Durchführung finden sich in der DIN 6855–4.
Die Qualitätskontrollprozeduren für PET umfassen eine Kalibrierungsmessung der Aktivität in einem Phantom mit einer bekannten Aktivitätskonzentration – für gewöhnlich als eine Funktion von axialer Position innerhalb des Gesichtsfelds. Eine tägliche Testung der Konstanz der einzelnen Detektoren sollte auch durchgeführt werden, um Detektorausfälle oder -drift identifizieren zu können. Zusätzlich sollte die PET/CT-Koregistrierung (mechanisch und elektronisch) regelmäßig, mindestens zweimal pro Jahr untersucht werden, in jedem Fall aber nach einem mechanischen Eingriff in das PET/CT-System. Diese Untersuchung der Gerätemechanik sollte eine etwaige mechanische Abweichung der PET- und CT-Komponenten des PET/CT-Tomographen aufdecken, die in die fusionierte Darstellung der Bilddaten einfließen muss, um eine korrekte Bildüberlagerung zu gewährleisten.
- Leistungsspezifikationen: Tomographen für Patientenuntersuchungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Notfallmaßnahmen
Eine Handlungsanweisung für die Erkennung und Behandlung von Notfällen ist allgemein zugänglich im Bereich der PET/CT-Untersuchungseinheit vorzuhalten. Dies gilt insbesondere für Unverträglichkeiten und allergoide bzw. anaphylaktoide Reaktionen auf iodhaltige Röntgenkontrastmittel. Das Personal muss regelmäßig geschult werden. Die notwendigen Medikamente und Geräte müssen vorhanden sein und sind regelmäßig zu überprüfen.
- Fehlerquellen
Falsch positive Befunde (Tab. 1) können durch physiologische Aufnahme von FDG in normalem Gewebe und durch benigne Erkrankungen verursacht werden. Nachfolgend sind – wenn auch nicht vollständig – die häufigsten Fehlerquellen zusammengestellt. Falsch negative Befunde können bei sehr kleinen Tumoren, unzureichender FDG-Avidität, Bewegung, hohem Blutzuckerspiegel oder Befunden in Bezirken hoher physiologischer FDG-Anreicherung (braunes Fettgewebe, FDG in Niere, Harn oder Gehirn) auftreten.
- Radiopharmazeutika
- Qualifikation des Personals
Die Nutzung eines PET/CT-Tomographen unterliegt den Regelungen der StrlSchV und RöV. Daher müssen die verantwortlichen Personen entweder über beide Fachkunden, nämlich gemäß der Richtlinie „Strahlenschutz in der Medizin“ und gemäß der Richtlinie „Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde vom 22. Dezember 2005“, verfügen oder entsprechend fachkundige Betreibergruppen bilden.
- Ärzte
Die PET/CT wird in der Onkologie mehr und mehr zu einer Standardmethode. Es besteht deshalb die Notwendigkeit, Qualifizierungswege für Nuklearmediziner und Radiologen zu schaffen, die beide Komponenten der PET/CT-Untersuchung durchführen und interpretieren. Unabhängig von der gebietsbezogenen Weiterbildung setzt die Befundung von PET/CT-Untersuchungen eine angemessene Expertise in der PET und der CT voraus.
Die Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin und die Deutsche Röntgengesellschaft sind in Gespräche eingetreten, um gemeinsame Vorschläge für eine Regelung zu entwickeln, die es Fachärzten beider Gebiete ermöglicht, die PET/CT durchzuführen.
- Technische Assistenz
Es gilt das MTA-Gesetz. Danach erfüllt die MTRA aufgrund der Ausbildung die Voraussetzung für die Bedienung sowohl des PET als auch der CT. Die PET/CT stellt an technische Assistenten jedoch praktische Anforderungen bezogen auf die Ausbildung, die Fortbildung und die Zertifizierung, damit sie für die Durchführung angemessen qualifiziert und kompetent sind. Die technische Durchführung von PET/CT-Untersuchungen ist neben den Ärzten ausschließlich erlaubt:
- Personen mit einer Erlaubnis nach §1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBl.I.S.1402), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (BGBl.I.S.3320,3323),
- Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich überwachten abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand ihrer Ausbildung und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,
- Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzung zur technischen Durchführung vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder MTRA Arbeiten ausführen, die ihnen im Rahmen ihrer Ausbildung übertragen sind, und sie die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen.
Falsch positive Befunde Physiologische
Aufnahme von FDG,
die zu falsch positiven
Befunden führen kannSpeicheldrüsen und lymphatisches Gewebe im Kopf- und Nackenbereich
Stimmlippen
Schilddrüse
braunes Fettgewebe
Thymus, insbesondere bei Kindern
laktierende Mamma
Brustareolen
Skelett und autochtone Muskulatur (Nacken, paravertebrale Muskulatur,Hyperinsulinämie)
Gastrointestinum (Ösophagus, Magen, Darm)
harnableitender Trakt
weiblicher Genitaltrakt (Uterus während Regelblutung oder Corpus luteum Zyste).entzündliche
Prozessenach chirurgischem Eingriff: entzündliche Veränderung, Infektion oder Hämatom; Biopsiestelle; Amputationsregion
nach Bestrahlung (z. B. Strahlenpneumonitis)
nach Chemotherapie
lokale entzündliche Prozesse, insbesondere granulomatöse Veränderungen (z. B. Sarkoidose,
Pilzerkrankungen, oder mykobakterielle Erkrankungen)
Stoma (Tracheo-, Ileo-) und Drainageschläuche
Injektionsstellen
Thyreoiditis
Ösophagitis, Gastritis, entzündliche Darmerkrankungen
akute oder chronische Pankreatitis
akute Cholangitis oder Cholezystitis
Osteomyelitiden, kurz zurückliegende Frakturen, Gelenkprothesen
Lymphadenitisbenigne
NeoplasienHypophysenadenom
Nebennierenadenom
Schilddrüsenadenom
Speicheldrüsentumoren (Whartin-Tumor oder pleomorphes Adenom)
adenomatöse Polypen und villöse Adenome des Kolons
Zystadenom des Ovars (Thekom)
Riesenzelltumor
aneurysmatische Knochenzyste
LeiomyomHyperplasien
oder
DysplasienMorbus Basedow
Morbus Cushing
Knochenmarkshyperplasie (Anämie oder nach Chemotherapie)
Thymus-Rebound (nach Chemotherapie)
fibröse DysplasieIschämie winterschlafendes Myokard Artefakte Eine fehlerhafte Überlagerung der PET- und CT-Daten kann Schwächungskorrekturartefakte verursachen. PET-Bilder ohne Schwächungskorrektur und PET/CT Fusionsbilder können zur Identifikation solcher Artefakte herangezogen werden.
Metall (z. B. Implantate) und hochdosierte CT-Kontrastmittelkonzentrationen können durch die Verwendung herkömmlicher CT-basierter Schwächungskorrekturalgorithmen zu Bildartefakten führen, die ebenfalls eine Verfälschung der berechneten Tracerkonzentrationen bewirken können
- Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder der MTRA tätig sind und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen.
- Personen mit einer Erlaubnis nach §1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBl.I.S.1402), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (BGBl.I.S.3320,3323),
- Medizinphysik-Experte
Entsprechend der Richtlinie 97/43 EUROATOM (vom 30.06.1997) Artikel 6 (3), der StrlSchV §9 Abs.3. Nr. 2 und der Richtlinie „Strahlenschutz in der Medizin“ Abschnitt 3.1.1.3 muss für die Durchführung von PET/CT–Untersuchungen ein Medizinphysik-Experte verfügbar sein. Dies kann gemäß der Richtlinie „Strahlenschutz in der Medizin“ z.B. durch eine vertragliche Vereinbarung erfolgen; in diesem Fall trifft die 15-Minuten-Regelung nicht zu.
Bei der Durchführung der PET/CT-Untersuchungen im Rahmen der medizinischen Forschung soll sichergestellt werden, dass bei der Planung und Anwendung ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen wird.
Der Medizinphysik-Experte besitzt die Fachkunde im Strahlenschutz und muss diese alle fünf Jahre durch einen anerkannten Kurs aktualisieren. Die Aufgaben des Medizinphysik-Experten erstrecken sich auf
- die Optimierung der Strahlenanwendung,
- den Strahlenschutz bei medizinischer Exposition,
- Beratung bei der Qualitätssicherung und Qualitätskontrollmaßnahmen (täglich: PET Daily Check, CT-Kalibrierung; monatlich: CT-Qualität, z. B. Lichtmarker, Schichtdicke, CT-Homogenität mit Phantom, Schichtposition; halbjährlich: Computertomographie-Dosimetrie-Indexphantom (CTDI), bei Bedarf: PET-Normalisierung, PET-CT offset Kalibrierung) und
- Beratung bei der Konstanzprüfung sowie bei Reparatur- und Wartungsmaßnahmen.
- die Optimierung der Strahlenanwendung,
- Ärzte
- Behördliche Entscheidungen zum Betrieb einer PET/CT-Einrichtung
Eine PET/CT-Einrichtung darf nur dann betrieben werden, wenn
- eine Umgangsgenehmigung nach § 7 StrlSchV für das vorgesehene Radionuklid vorliegt und
- der Betrieb der Röntgenkomponente des PET/CT-Gerätes nach § 3 oder § 4 der RöV zugelassen ist.
- eine Umgangsgenehmigung nach § 7 StrlSchV für das vorgesehene Radionuklid vorliegt und
- Adolf E, Chatterjee T, Ince H, et al. Kontrastmittel-induzierte Nephropathie. Klinik und Prävention. Dtsch Med Wochenschr 2005; 130: 2391–2396.
- Allen-Auerbach M, Yeom K, Park J, Phelps M, Czernin J. Standard PET/CT of the chest during shallow breathing is inadequate for comprehensive staging of lung cancer. J Nucl Med 2006; 47: 298–301.
- Antoch G, Freudenberg LS, Egelhof T et al. Focal tracer uptake: a potential artifact in contrast-enhanced dual-modality PET/CT scans. J Nucl Med 2002; 43: 1339–1342.
- Antoch G, Freudenberg LS, Beyer T, Bockisch A, Debatin JF. To enhance or not to enhance? 18F-FDG and CT contrast agents in dual-modality 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med 2004; 45: 56S-65S.
- Antoch G, Vogt FM, Freudneberg LS, et al. Whole-body dual-modality PET/CT and whol-body MRI for tumor staging in oncology. JAMA 2003; 290: 3199–3206.
- Berthelsen A, Holm S, Loft A, Klausen T, Andersen F, Højgaard L. PET/CT with intravenous contrast can be used for PET attenuation correction in cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 32: 1167–1175.
- Beyer T, Townsend DW, Brun T et al. A combined PET/CT scanner for clinical oncology. J Nucl Med 2000; 41: 1369–1379.
- Beyer T, Rosenbaum S, Veit P, et al. Respiration artifacts in whole-body 18F-FDG PET/CT studies with combined PET/CT tomographs employing spiral CT technology with 1 to 16 detector rows. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 32: 1429–1439.
- Beyer T, Townsend DW. Putting 'clear' into nuclear medicine: a decade of PET/CT development. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: 857–861.
- Blodegtt TD, Meltzer CC, Townsend DW. PET/CT: Form and Function. Radiology 2007, 242: 360–385.
- Brix G, Beyer T. PET/CT: dose-escalated image fusion? Nuklearmedizin 2005;44 (Suppl 1): S51–S57.
- Brix G, Lechel U, Glatting G, Ziegler SI, Münzig W, Müller SP, Beyer T. Radiation exposure of patients undergoing whole-body dual-modality 18F-FDG PET/CT examinations. J Nucl Med 2005; 46: 608–613.
- Bundesamt für Strahlenschutz. Bekanntmachung der diagnostischen Referenzwerte für radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen. Bundesanzeiger 2003; 143: 17503–17504.
- Cohade C, Osman M, Nakamoto Y et al. Initial experience with oral contrast in PET/CT: phantom and clinical studies. J Nucl Med 2003; 44: 412–416.
- Coleman RE, Delbeke D, Guiberteau MJ et al. Concurrent PET/CT with an integrated imaging system: intersociety dialogue from the joint working group of the American College of Radiology, the Society of Nuclear Medicine, and the Society of Computed Body Tomography and Magnetic Resonance. J Nucl Med 2005; 46: 1225–1239.
- Czernin J. PET/CT: imaging structure and function. J Nucl Med 2004; 45 (suppl 1): 1S-103S.
- Czernin J, Allen-Auerbach M, Schelbert HR. Improvements in cancer staging with PET/CT: Literature-based evidence as of September 2006. J Nucl Med 2007; 48 (Suppl 1): 78S-88S.
- Delbeke D, Coleman RE, Guiberteau MJ et al. Procedure guideline for tumor imaging with 18F-FDG PET/CT 1.0. J Nucl Med 2006; 47: 885–895.
- Dizendorf E, Hany TF, Buck A et al. Cause and magnitude of the error induced by oral CT contrast agent in CT-based attenuation correction of PET emission studies. J Nucl Med 2003; 44: 732–738.
- Erdi YE, Nehmeh SA, Pan T, et al. The CT motion quantitation of lung lesions and its impact on PET-measured SUVs. J Nucl Med 2004; 45: 1287–1292.
- Franzius C, Schober O. Is PET/CT necessary in pediatric oncology? For. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: 960–965.
- Gambhir SS, Czernin J, Schwimmer J et al. A tabulated summary of the FDG PET literature. J Nucl Med 2001; 42 (Suppl): 1S-93S.
- Goerres GW, von Schulthess GK, Steinert HC. Why most PET of lung and head-and-neck cancer will be PET/CT. J Nucl Med 2004; 45 (suppl 1): 66S-71S.
- Grosu AL, Piert M, Weber WA et al. Positron emission tomography for radiation treatment planning. Strahlenther Onckol 2005; 181: 483–499.
- Halpern BS, Dahlbom M, Auerbach MA, et al. Optimizing imaging protocols for overweight and obese patients: A lutetium orthosolicate PET/CT study. J Nucl Med 2005; 46: 603–607.
- Hausegger K, Reinprecht P, Kau T, Igerc I, Lind P. Clinical experience with a commercially available negative oral contrast medium in PET/CT. Fortschr Roentgenstr 2005; 177: 796–799.
- Hays MT, Watson EE, Thomas SR, Stabin M. MIRD dose estimate report no. 19: Radiation absorbed dose estimates from 18F-FDG. J Nucl Med 2002; 43: 210–214.
- Jaskowiak CJ, Bianco JA, Perlamn SB, Fine JP. Influence of reconstruction iterations on 18F-FDG PET/CT standardized uptake values. J Nucl Med 2005; 46: 424–428.
- Kim J, Czernin J, Auerbach M, et al. Comparison between 18FDG-PET, in-line PET/CT, and software fusion for restaging of recurrent colorectal cancer. J Nucl Med 2005; 46: 587–595.
- Kinahan PE, Hasegawa BH, Beyer T. X-ray-based attenuation correction for positron emission tomography/computed tomography scanners. Semin Nucl Med 2003; 33: 166–179.
- Kuehl H, Antoch G. How much CT do we need for PET/CT? A radiologist's perspective. Nuklearmedizin 2005; 44 (suppl 1): S24–S31.
- Nakamoto Y, Chin BB, Kraitchman DL et al. Effects of nonionic intravenous contrast agents at PET/CT imaging: phantom and canine studies. Radiology 2003; 227: 817–824.
- Nestle U, Kremp S, Grosu AL. Practical integration of [18F]-FDG-PET and PET-CT in the planning of radiotherapy for non-small cell lung cancer (NSCLC): the technical basis, ICRU-target volumes, problems, perspectives. Radiother Oncol 2006; 81: 209–225.
- Noßke D, Minkov V, Brix G. Festlegung und Anwendung diagnostischer Referenzwerte für nuklearmedizinische Untersuchungen in Deutschland. Nuklearmedizin 2004; 3: 79–84.
- Osman MM, Cohade C, Nakamoto Y et al. Clinically significant inaccurate localization of lesions with PET/CT: frequency in 300 patients. J Nucl Med 2003; 44: 240–243.
- Pan T, Malawi O, Nehmeh S et al. Attenuation correction of PET images with respiration-averaged CT images in PET/CT. J Nucl Med 2005; 49: 1481–1487.
- Paquet N, Albert A, Foidart J et al. Within-patient variability of 18F-FDG: standardized uptake values in normal tissues. J Nucl Med 2004; 45: 784–788.
- PET-CT Consensus Conference; SNMTS; American Society of Radiologic Technologists (ASRT). Fusion imaging: a new type of technologist for a new type of technology. J Nucl Med Technol 2002; 30: 201–204.
- Pietrzyk U. Does PET/CT render software fusion obsolete? Nuklearmedizin 2005; 44 (suppl 1): S13-S17.
- Richtlinie „Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde vom 22. Dezember 2005“. GMBI 2006; 22: 413.
- Strahlenschutz in der Medizin. Richtlinie nach der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 24. Juni 2002. Bundesanzeiger 2002; 207a.
- Strahlenschutzkommission. Strahlenschutz bei der Anwendung der Positronen-Emissions-Tomographie/Computer-Tomographie (PET/CT). Stellungnahme vom 08./09.12.2005. http://www.ssk.de/werke/kurzinfo/2005/ssk0513.htm
- Townsend DW, Beyer T, Blodgett TM. PET/CT scanners: a hardware approach to image fusion. Semin Nucl Med 2003; 33: 193–204.
- Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714, 2002 I S. 1459), zuletzt geändert durch Artikel 2, § 3 Abs. 31 des Gesetzes vom 1. September 2005. BGBl. I S. 2618, 2658.
- Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlung (Röntgenverordnung – RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003. BGBl. I S. 604.
- Verordnung zur Änderung der Verordnung über radioaktive oder mit ionisierenden Strahlen behandelte Arzneimittel vom 22.12.2006. BGBI 2006 I S. 3462.
- Wahl RL. Why nearly all PET of abdominal and pelvic cancers will be performed as PET/CT. J Nucl Med 2004; 45 (suppl 1): S82-S95.
- Weber WA. Positron emission tomography as an imaging biomarker. J Clin Oncol 2006; 24: 3282–3292.
- Yau YY, Chan WS, Tam YM et al. Application of intravenous contrast in PET/CT: does it really introduce significant attenuation correction error? J Nucl Med 2005; 46: 283–291.
- Young H, Baum R, Cremerius U et al. Measurement of clinical and subclinical tumour response using 18F-fluorodeoxyglucose and positron emission tomography: review and 1999 EORTC recommendations. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) PET Study Group. Eur J Cancer 1999; 35: 1773–1782.
Prof. Dr. B. J. Krause
Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität
Ismaninger Str. 22, 81675 München
Tel. 0 89/41 40 29 61
Fax 0 89/41 40 49 50
E-Mail: bernd-joachim.krause@tum.de
Leitlinie: FDG-PET/CT in der Onkologie
| zurück zur Übersicht |